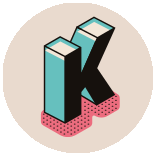Warum fragt man nicht die, die Kunst und Kultur in Anspruch nehmen?
Ein Gespräch mit Martin Fritz, freischaffender Kurator und Publizist über Rollen, Erwartungshaltungen, Aufgaben, gesellschaftliche Wirkung und Teilhabe sowie Erfolgsfaktoren im Kunstbereich
Was hat Covid-19 über den Zustand unserer Gesellschaft aufgezeigt, und was wünscht du dir aus diesen Erfahrungen heraus für die Zukunft?
Covid-19 hat uns gezeigt, wie verwundbar unsere Wirtschaft und Gesellschaft ist. Wenn schon so wenige Wochen Pause bzw. Stillstand dafür reichen, dass weite Teile unserer Wirtschaft und Gesellschaft nahe ans Scheitern kommen, dann müssen wir schmerzlich erkennen, wie wenig Reserve, wie wenig Spielraum in den Systemen ist. Es muss mehr von diesen Reserven geben, wir dürfen nicht so stark vom ökonomischen Kreislauf abhängen.
Wir müssen entweder krisenfester werden, oder erkennen, dass es so nicht mehr weitergehen kann.
Welche Rolle kann und soll Kunst und Kultur in dieser Gesellschaft spielen?
Ich befürchte ja, dass sich die Fragilität und Prekarisierung, die Ungleichheit und Ungerechtigkeit verschärfen und verschlimmern wird. Ich glaube nicht, dass wir gestärkt aus der Krise rausgehen, auch wenn das jetzt die große Chance ist. Und natürlich wünscht man sich, dass Kunst und Kultur zu jenen Kräften in der Gesellschaft gehören, die solche Krisen reflektieren können, einen Beitrag dazu leisten, sie auszuhalten, einen Betrag dazu zu leisten, sie zu überwinden. Die Konflikte, die damit verbunden sind, zur Sprache zu bringen, sie bewältigbar und aushaltbar zu machen.
Ist das eine neue Rolle für Kunst und Kultur?
Nein, ich glaube, dass das eine originäre Rolle ist, eine von vielen. Ich würde Kunst und Kultur auch nicht auf eine Rolle fixieren wollen. Das Schöne ist ja die Vielzahl von Rollen, die vom wunderbar entspannenden Genuss bis hin zu den verstörendsten existentiellen Erfahrungen reichen können. Das ist alles drin und notwendig. Allerdings, wenn wir von einer stark öffentlich finanzierten Kunst und Kultur reden, dann hat diese natürlich Aufgaben.
Sprichst du damit die Rolle der Kunst- und Kulturinstitutionen an?
Ja, etwaige Verpflichtungen kommen ja nicht aus einer bestimmten Erwartungshaltung an Kunst und Kultur generell, sondern an die öffentlich geförderte Infrastruktur für Kunst & Kultur.
Es gibt sehr wohl so etwas wie gesellschaftliche Vorgaben an Kulturinstitutionen, die damit zu tun haben, dass sich eine Gesellschaft entscheidet diese gemeinsam zu tragen und zu erhalten. Dann hat die Gesellschaft natürlich Teilhaberechte und müsste entsprechend auch vielfältige Möglichkeiten zur Teilhabe vorfinden.
Etwas, das einen Nutzen oder eine Wertigkeit hat, auch wenn es Herausforderungen beinhaltet.
Was die Frage der Wirkung aufwirft. Welche Wirkung soll eine Kunstinstitution erzielen, beim Besucher, in einer bestimmten Community, in der Stadt, in der Gesellschaft generell?
Die Erfahrung der letzten Monate hat gezeigt, dass Kunstinstitutionen gerade in unsicheren und krisenhaften Zeiten die Rolle der qualitätsvollsten und verantwortungsvollsten, auch achtsamsten öffentlichen Räume spielen könnten.
Sie könnten genau jene Orte sein, wo für eine Gesellschaft auch dann, wenn sie keine Arbeit hat, wenn das wirtschaftliche Leben droht zusammenzubrechen, wenn sie kurzfristig oder längerfristig über kein Geld verfügt, eine gemeinsame qualitätsvolle Erfahrung möglich ist.
Eine Rolle, die jede öffentliche Infrastruktur mit ihren jeweiligen Mitteln hat. Der Park übernimmt so eine Rolle, das Museum übernimmt so eine Rolle, das Schwimmbad übernimmt so eine Rolle, die Bibliotheken übernehmen so eine Rolle.
Was müsste sich in den Institutionen ändern, damit sie diese Rolle einnehmen können?
Ich habe einmal geschrieben, dass sich die Vertreterinnen und Vertreter der Kunstinstitutionen nur als Nutzer fühlen sollen, und nicht als Eigentümer.”
Wenn jemand eine öffentliche Institution betreibt und leitet, dann sollte dies im Bewusstsein geschehen, dass man mit seiner Forschung, mit seiner Kunstgeschichte, mit seinen Schauspielern, mit seinen Kuratorinnen auch nur Nutzer einer öffentlichen Infrastruktur ist, zusammen mit vielen anderen.
Nicht zu sagen, „Moment, das ist mein Ding und ich definiere unter welchen Bedingungen alle anderen hier teilhaben dürfen“. Das sollten schon auch die „Miteigentümer“, denen die öffentliche Infrastruktur zur Verfügung steht, mitentscheiden können.
Geht das in Richtung zivilgesellschaftliches Selbstverständnis als Kunstinstitution, was auch hieße, weg vom elitären Selbstverständnis?
Ja! Wobei es natürlich eklatante Unterschiede gibt, man darf hier nicht verallgemeinern. Es gibt ja auch die Brunnenpassage, das Frauenmuseum, und viele kleine Organisationen und ehrenamtliche Kulturvereine. Wovon ich spreche, das sind die elitenorientierten Großinstitutionen, die wenig Teilhabeoptionen entwickelt haben. Diesen stehen auf der anderen Seite sehr viele soziokulturelle, und aus ganz anderen Alternativkulturen gespeiste Zugänge gegenüber, schon seit Jahrzehnten eigentlich, nur dringen sie in Österreich nie durch auf die Ebene der Großinstitutionen.
Warum ist das so? Und was könnte man tun, damit sich das ändert?
Ich glaube, dass die Großinstitutionen und ihre Exponenten ein viel größeres öffentliches Gehör finden. Auch jetzt wieder, in der Corona-Krise. Die Bundesmuseen, die Salzburger Festspiele. Man müsste mal ganz strategisch und präzise auf kulturpolitischer Ebene die Aufmerksamkeit von den einen zu den anderen Akteuren und Akteurinnen lenken. Man müsste endgültig die Kunstentwicklung der letzten 50 Jahre überhaupt erst verstehen, kulturpolitisch, und dem Umstand ins Auge blicken, dass auch alternative Kunstinstitutionen Budgets von 20-30 Millionen haben könnten.
Die etablierte Hierarchie drückt sich ja vor allem budgetär und in Ressourcen aus.
Das heißt, es ist die Aufgabe der Kulturpolitik, den Wandel hin zu zivilgesellschaftlichen Kulturakteuren zu unterstützen?
Ja, ich glaube es ist generell die Aufgabe von Politik attraktive Zukunftsbilder für gesellschaftliche Bereiche zu entwickeln und auf Lager zu haben.
Und ein attraktives Zukunftsbild für die Kultur ist ja nicht, dass alles so bleibt, wie es ist, sondern dass sich Gesellschaft in all ihrer Vielfalt wiederfindet.
Wer könnte diesbezüglich Einfluss auf die Kulturpolitik ausüben?
Die freie Kunstszene, möglicherweise auch der gemeinnützige Sektor. Mir schweben da Allianzen vor, überall dort, wo es um öffentliche Infrastruktur geht, z.B. Bildung oder Freizeit. Man kann es ja in Städten jetzt schon beobachten, diese neuen Konstellationen von Orten, diese Mischformen, wie Maker-Spaces, Mediencenter, Orte für Jugendarbeit. In Wien könnte das das Erbe der Volkshochschulen und der Häuser der Begegnung sein.
Muss sich auch programmatisch, inhaltlich etwas verändern?
Wenn sich gesellschaftspolitische und soziale Anliegen und die veränderte Gesellschaft nicht in den Inhalten und den grundlegenden Programmatiken widerspiegeln, dann kann man rauf und runter vermitteln, es ändert nichts. Ein banales Beispiel: türkischsprachige Menschen wollen vielleicht türkischsprachiges Theater, oder türkische Klassik in der Musik, und wenn man die nie in einer der großen Kunstinstitutionen sieht oder hört, dann werden türkischsprachige Menschen höchstwahrscheinlich nicht oder viel seltener hingehen. Sie sind aber Teil der Gesellschaft mit einem Teilhaberecht an Kunst und Kultur.
Woran sollte man in Zukunft den Erfolg von Kunstinstitutionen messen? Sind Besucherzahlen und andere quantitative Output-Kennzahlen relevant und aussagekräftig, wie erfolgreich eine Institution agiert?
Das große Signal ist für mich Kooperationsfähigkeit, Einbettung in Netzwerke, Vielfalt der Kooperationen und Beziehungen. In wie viele verschiedene Richtungen vernetzt sich ein Angebot?
Das kann man durchaus quantifizieren. Wichtig ist, welchen Gruppen das welche Teilhabemöglichkeiten eröffnet. Das ist zwar schwieriger, aber es gibt ja Vorbilder dafür. Soziologische und demographische Kennzahlen zum Beispiel, solange sie als Ausdruck einer bestimmten Beziehungsstruktur dienen. Es geht nicht darum, dass tausende Leute sagen, sie haben dort ihre bildungsferne Herkunft überwinden können, aber einer muss es sagen und überzeugend davon berichten können. Zum Beispiel, dass ihm die Teilnahme an einem Projekt wie Superar eine Welt eröffnet hat, die ihm oder ihr ohne diesen Impuls verschlossen geblieben wäre. Also, die Kennzahlen müssten auf jeden Fall etwas aussagen über die Vielfalt der Beziehungen.
Das heißt also, die Leute befragen? Die Stimmen abholen und ihre Geschichten hören?
Ja, vor allem, wenn man weiß, wen man fragen kann. Ich habe mir in der Corona-Krise oft gedacht, warum hört man den immer nur von den Direktoren und Direktorinnen, wie wichtig ihre Organisationen sind?
Warum fragt man nicht die, die Kunst und Kultur in Anspruch nehmen?
Warum übersieht man, dass es sehr viel überzeugender ist, wenn die Nutzerin der Bibliothek sagt, ich halte es ohne Bibliothek nicht mehr aus, ich möchte wieder hin. Wenn man eine Vielfalt an Beziehungen hat und pflegt, dann hat man auch eine Vielfalt an Zeugen und Zeuginnen für Bereicherung, für Kontaktpotential, für Lerneffekte.
In deiner Rolle als Stakeholder, was kannst du bewirken und welche Beziehungen würdest du dir wünschen?
Ich achte auf bestimmte Dinge, auf die andere nicht so sehr achten, weil ich darin geschult bin – ich achte auf Governancestrukturen, auf ökonomische Strukturen, auf Statistiken, auf politische Texte, auf Rechtsgrundlagen. Das bringe ich dann oft als Text, oder als Beratung, oder als Beteiligung an einem Projekt ein, und dann hat es auch einen ganz konkreten Nutzen. Generell glaube ich, dass frei agierende Stakeholder wie ich genau dort am besten einen Betrag leisten können, wo man nicht von Anfang an in der Systemlogik verhaftet ist. Menschen, die lange und leider oft auch zu lange in einer Institution sind, reflektieren schlicht und ergreifend nicht mehr, sie kennen nur einen Blickwinkel und den verabsolutieren sie. Es ist der Blickwinkel aus einer definierten Position, einer bestimmten Ausbildung, zu einer bestimmten Zeit. Externe Stakeholder können da die Perspektiven vervielfältigen.
Das heißt sich den Blick von außen, zum Beispiel von Freischaffenden, immer wieder rein zu holen, sollte Teil eines gezielten Stakeholder Management sein? Aber sind die Kunstinstitutionen nicht sehr zurückhaltend mit externer Expertise?
Ja, das stimmt, sie wollen zwar Publikum, aber sie wollen kein Co-Ownership, und daher auch keine wirklichen Beziehungen zu externen und anderen Mitgliedern der Zivilgesellschaft. Man darf sich zwar an ihren Programmen beteiligen, aber zu den Regeln, die die Institution selbst aufstellt. Partizipation, sagt Nora Sternfeld, müsste aber bedeuten, auch die Regeln verändern zu können. Ansonsten ist es ein falsch verstandenes Stakeholder Management, nur damit sich alle wohl fühlen. Der Input muss viel konsequenter, vielfältiger und professioneller strukturiert werden. Ansonsten fehlt er, und das merkt man dann auch. Und man erntet im schlechtesten Fall Ignoranz, als Wegbleiben, als Nicht-Verteidigen. Wichtige Stakeholder-Gruppen bleiben weg, sie stehen nicht zur Verfügung, um etwas zu verteidigen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Sie wenden sich anderen Angeboten zu oder formieren Gegenbewegungen, Kritik oder Protest.
Man hat ja die Wahl. Nichts bleibt ohne Auswirkungen.