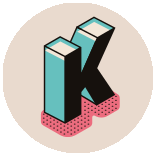Ein Haus, das der Öffentlichkeit gehört und eine geistige und visuelle Bereicherung ist, wenn man es besucht.
Ein Gespräch mit Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museum, Wien, über die Auswirkungen der Corona-Pandemie, über Chancen, Paradigmenwechsel, neue Rollenbilder und zukünftige Finanzierungsmodelle.
Unter den Kunstmuseen in Österreich ist das Leopold Museum als Privatstiftung eines der wenigen Museen, die mehrheitlich privatwirtschaftlich finanziert sind. Zu den Eigenleistungen gehören auch Einnahmen aus Eintrittsgeldern. Der Fokus auf hohe Besucherzahlen sichert die Existenz, ermöglich auch ein notwendiges Ankaufs-Budget sowie eine Reihe weiterer institutioneller Aufgaben. Die Corona-Pandemie bedeutet für das Museum daher in erster Linie eine große wirtschaftliche Herausforderung.
Wir sind auf hohe Besucherzahlen fokussiert, die unsere Existenz bedeuten. Das waren in den letzten beiden Jahren zwischen 420.000 und 520.000 Besucher. Davon ist abhängig, welche Aktivitäten wir setzen können. Ein gut laufendes Jahr impliziert zum Beispiel auch, dass wir ein Ankaufs-Budget haben. Ein Museum versteinert ja, wenn es im Sammlungsbereich nicht weitergeht und wenn Lücken nicht geschlossen werden. Mit dem Besucher- und Umsatzeinbruch durch Corona sind Ankäufe nun undenkbar. Aber auch unsere Marketingausgaben sind wesentlich vom Umsatz abhängig, ebenso die Kunstvermittlungsaktivitäten. Was können wir für Schulklassen machen, für Jugendliche, für Lehrlinge. Insofern betrifft der ökonomische Aspekt der Krise alle Bereiche des Hauses.
Uns sind derzeit rund 90% der Touristen weggebrochen, und das sind zwei Drittel unserer Besucher. Es wird noch einige Zeit dauern, bis die Tourismusmärkte wieder so funktionieren, wie sie die letzten Jahre funktioniert haben.
Seit der Wiedereröffnung haben wir rund 90% österreichische Besucher. Das heißt aber, wir sind jetzt im Schnitt bei 450 Besucher pro Tag, gegenüber bisher rund 2.000, also etwa ein Viertel. Bis es entsprechende Medikamente gibt, wird sich da so schnell nichts ändern.
Wie reagiert man auf diese Herausforderungen? Gibt es neben kurzfristigen Einsparungen eine langfristige Perspektive, die eine Chance darstellt?
Es wird in der Programmierung von Ausstellungen ganz generell ein Umdenken geben. Welche Formate konzipiert man, was kann realisiert werden?
Immer mehr, immer rascher, immer teurer, das wird es so schnell nicht wieder geben, weil es nicht mehr leistbar ist. Man wird wieder mehr auf die eigene Sammlung zurückgreifen, was ich als sehr positiv empfinde.
Was bedeutet das für das Leopold Museum?
Wir waren nie das Haus, das einen Blockbuster nach dem anderen produziert hat. Als ich das Haus vor knapp 5 Jahren als Direktor übernommen habe, war es mir sehr wichtig, an der DNA des Hauses zu arbeiten, ob das jetzt Wien um 1900 ist oder aktuell die Verbindung zwischen Schiele und Hundertwasser. Unsere Ausstellungen werden aus der Identität des Hauses heraus konzipiert, und da gibt es noch viele Möglichkeiten, die kunsthistorisch noch nicht aufgearbeitet sind.
Diesen Paradigmenwechsel weg von teuren Ausstellungsproduktionen hin zur Auseinandersetzung mit der eigenen Sammlung ist das Gebot der Stunde.
Wie geht man mit der Veränderung der Besucherstruktur um? Wie kann man das lokale Publikum gewinnen und binden?
Es ist natürlich für jeden Kunstvermittler – als der ich mich auch verstehe – eine Idealvorstellung, dass man beim heimischen Klientel das Ziel erreicht, ein Ort des Zusammentreffens, der Reflexion zu sein. Ein sozialer Ort, wo man Vergangenheit und Gegenwart reflektiert. Gleichzeitig wissen wir, dass der kunstaffine Anteil an der heimischen Bevölkerung speziell im Bereich der bildenden Kunst marginal ist, und wir vom österreichischen Publikum leider nicht leben können. (…)
Aber Not macht erfinderisch. Wir denken permanent über neue Stakeholder und Partner nach, die für uns wichtig sein könnten. Wir haben drei Monate vor der Corona-Krise einen Patrons-Club für die Jungen entwickelt, die 20- bis 45-Jährigen. Die sind dann nicht mit 3.000, sondern mit 300 Euro dabei, und bekommen ein reiches Veranstaltungsprogramm geboten, das von Diskursveranstaltungen bis zu Atelierbesuchen reicht. Wir initiieren neue Partnerschaften, unter anderen mit der Arbeiterkammer, die unseren Fokus auf Schüler und Lehrlinge tatkräftig unterstützt. Wir halten Ausschau nach allen möglichen Zielgruppen und Partnern. Wir wollen sozusagen rein in die Gesellschaft.
Unser Bestreben ist es, vom Image einer Privatstiftung, die Wohlhaben suggeriert, was ganz und gar nicht der Fall ist, wegzukommen, zu einem Museum, das der Öffentlichkeit gehört und eine geistige und visuelle Bereicherung ist, wenn man es besucht.
Wie wichtig ist dabei der Kontext sozialer, gesellschaftlicher Veränderungen und Herausforderungen?
Wir sind relativ streng an einem gewissen Narrativ der Kunstgeschichtsschreibung orientiert. Das ist im Stiftungsstatut auch so vorgesehen und orientiert sich am existierenden Sammlungsprofil. Daher machen wir kein „Kunsthallen“-Programm. Ich finde das gut so, denn jedes Haus hat seine Identität zu pflegen, sonst wird es unübersichtlich und beliebig. Es sollte nicht sein, dass man Programme ohne Rücksicht auf die ureigene Identität der Institution realisiert. Man muss also wiedererkennbar bleiben.
Was wird die Corona-Krise im Kunstbereich generell verändern? Worüber muss man nachdenken, woran muss man arbeiten?
Man muss die derzeitigen Erfolgsparameter für öffentlich finanzierte Häuser reflektieren. Was verpufft, was ist nur ein schnelles Aufblitzen und was bleibt längerfristig von Bedeutung für die Reputation und Identität eines Hauses? Es wird neue Förderstrukturen und neue Geschäftsmodelle brauchen. Die staatlichen Subventionen werden nicht ausreichen, um die Kunstinstitutionen in Zukunft zu finanzieren. Es gibt Beispiele aus Deutschland, wo die Länder wie der Bund staatsnahe Unternehmen (wie z.B. Lotterien) in die Pflicht nehmen, dass also ein bestimmter Prozentsatz der Einnahmen für Kunstinstitutionen investiert werden muss. Auch Beispiele wie Kulturstiftungen machen Sinn. In diese Richtung muss man denken. Das geht aber nur durch eine gesetzlich vorgegebene Struktur. Lücken in Sammlungsbeständen, die jetzt nicht gefüllt werden können, wird man zwar erst in 20, 30 Jahren schmerzlich bemerken, dann ist es allerdings zu spät, um diese zu kompensieren.
Man muss jetzt in die Zukunft denken, gerade auch in Krisenzeiten.